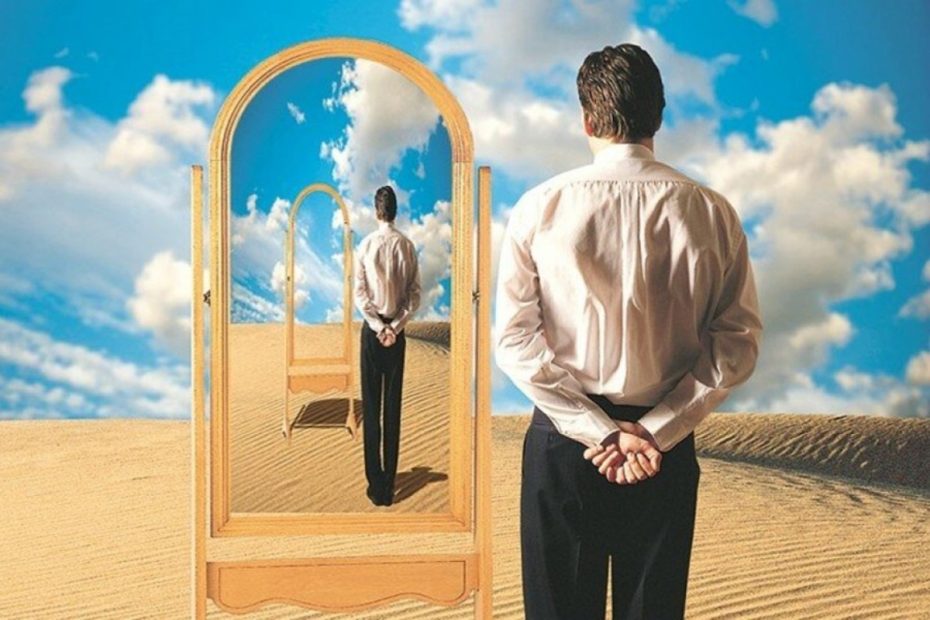Eine Neuropsychologin erklärte, dass das Gefühl, ein Ereignis bereits erlebt zu haben, zeigt, wie das Gehirn falsche Erinnerungen erzeugen kann, und welche inneren Mechanismen den Unterschied zwischen Realität und Vorstellung regulieren.

Déjà-vu – „ein falsches Gefühl der Vertrautheit, das in unserem Gehirn aktiviert wird, auch wenn wir wissen, dass das Erlebte nie stattgefunden hat”.
Das Phänomen aus neurobiologischer Sicht
Déjà-vu ist ein Gefühl der Vertrautheit ohne reale Erinnerungen, die es bestätigen würden, wie Crivelli während der Morgensendung erklärte
Die Expertin sagt, dass Déjà-vu „ein faszinierendes Beispiel dafür ist, wie Erinnerung und Wahrnehmung in Konflikt geraten“, da das Gefühl, dass die Situation bereits erlebt wurde, auftritt, obwohl man sich bewusst ist, dass das Geschehen nicht real ist.
Die Expertin erklärte, dass der Begriff „Déjà-vu“ 1870 vom französischen Psychologen Émile Boirac eingeführt wurde, der sich für dieses Phänomen interessierte, das bereits in die Volkskultur und einige mystische Theorien Eingang gefunden hatte. Das Hauptgefühl ist das Gefühl, dass die Situation vertraut erscheint, „als hätten wir sie schon einmal erlebt, obwohl wir wissen, dass dies nie der Fall war”. Crivelli behauptet: „Bei einem Déjà-vu ist man sich sicher, dass etwas nicht stimmt; diese Erinnerung ist falsch”.
Aus neurobiologischer Sicht gibt es mehrere Erklärungen. Laut dem Experten tritt dieses Phänomen häufiger bei Menschen mit Epilepsie des mesialen Temporallappens auf: „Bei einigen Patienten ist Déjà-vu sogar Teil eines epileptischen Anfalls und wirkt wie eine „Aura“, die durch eine Funktionsstörung dieses Bereichs des Gehirns verursacht wird.“ Der Schlüsselbereich, der an diesem Prozess beteiligt ist, ist der entorhinalen Kortex, der für das Gefühl der Vertrautheit verantwortlich ist. „Wenn dieser Bereich überreizt wird, tritt Déjà-vu auf, während der Hippocampus, der für das Abrufen echter Erinnerungen und Details verantwortlich ist, während der Episode inaktiv bleibt.“
Wissenschaftliche Experimente und die Rolle des Gehirns
Dieses Phänomen wurde mithilfe elektrischer Stimulation bei Epilepsiepatienten untersucht: „Mit Hilfe von tief in den Temporallappen eingeführten Elektroden konnten die Wissenschaftler künstlich ein Déjà-vu hervorrufen und beobachten, dass der Hippocampus inaktiv bleibt, während der Frontallappen signalisiert, dass „etwas nicht stimmt“. So, erklärt der Experte, „erkennt der Mensch das Gefühl der Vertrautheit, weiß aber, dass die Erinnerung unbegründet ist“.
Die Funktion des präfrontalen Kortex ist entscheidend: Er ist für die Überwachung und Signalisierung von Konflikten im Prozess der Gehirnaktivität verantwortlich und weist darauf hin, dass das Erlebte nicht real ist. „Dieser Bereich warnt uns, dass die Vertrautheit keine reale Grundlage im Gedächtnis hat.“
Psychoanalytische Theorien und unbewusste Komponenten

Obwohl die Neurobiologie heute überzeugende Antworten bietet, hat Crivelli historische Erklärungen für Déjà-vu analysiert. Die Psychoanalyse interpretierte es als Eindringen des Unbewussten: „Aus der Sicht von Lacan wurde Déjà-vu als das Erscheinen von „Geistern“ der Vergangenheit oder des Unbewussten betrachtet, die in ähnlichen Situationen auftauchen, sich aber nicht vollständig offenbaren können.“
Häufigkeit, Faktoren und Varianten von Déjà-vu
Stress, Müdigkeit und Überlastung können die Wahrscheinlichkeit eines Déjà-vu erhöhen, betont der Experte
Neuropsychologen behaupten, dass „die meisten Menschen mindestens einmal in ihrem Leben ein Déjà-vu erleben”, insbesondere nach der Pubertät und bis zum Alter von 55 Jahren. Mit zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit aufgrund der nachlassenden Funktion des Frontallappens deutlich ab. Laut der Expertin hängt dieses Phänomen nicht mit dem Geschlecht oder dem Bildungsniveau zusammen: „Sein Auftreten hängt ausschließlich von der Aktivierung bestimmter Bereiche des Gehirns ab.“
Die Neuropsychologin wies darauf hin, dass es am häufigsten in Momenten der Müdigkeit, des Stresses oder der Überlastung auftritt und durch den Verlust der Synchronität der neuronalen Schaltkreise verursacht werden kann.
In Bezug auf die verschiedenen Formen von Déjà-vu bemerkte sie: „Es kann sich visuell manifestieren, wenn man einen Ort betritt; auditiv, beim Hören vertrauter Geräusche; oder beim Anblick von Gesichtern, die wir für vertraut halten, aber als fremd erkennen.“ Sie fasste zusammen, dass jede Episode drei Merkmale vereint: Die Situation kommt einem bekannt vor, ihre Herkunft ist nicht identifizierbar und sie wird als seltsam oder unwirklich empfunden.
Gedächtnis, Emotionen und Pflege des Gehirns
Die Neuropsychologin betonte, dass Déjà-vu „von der Integration von Emotionen, Gedächtnis und Wahrnehmung zeugt“, und riet, solche Episoden nicht zu fürchten, sondern sie als kurioses und natürliches Phänomen des Geistes zu betrachten.
Abschließend betonte die Expertin, dass man dieses Phänomen aus wissenschaftlicher Sicht verstehen sollte, ohne die Rolle historischer Theorien zu unterschätzen, die den Weg zu modernen Erklärungen geebnet haben: „Déjà-vu ist keine Krankheit, sondern ein Ausdruck dafür, wie Erinnerung und Wahrnehmung sich vermischen können und das erstaunliche Gefühl hervorrufen, dass man etwas erlebt hat, was nie passiert ist.”